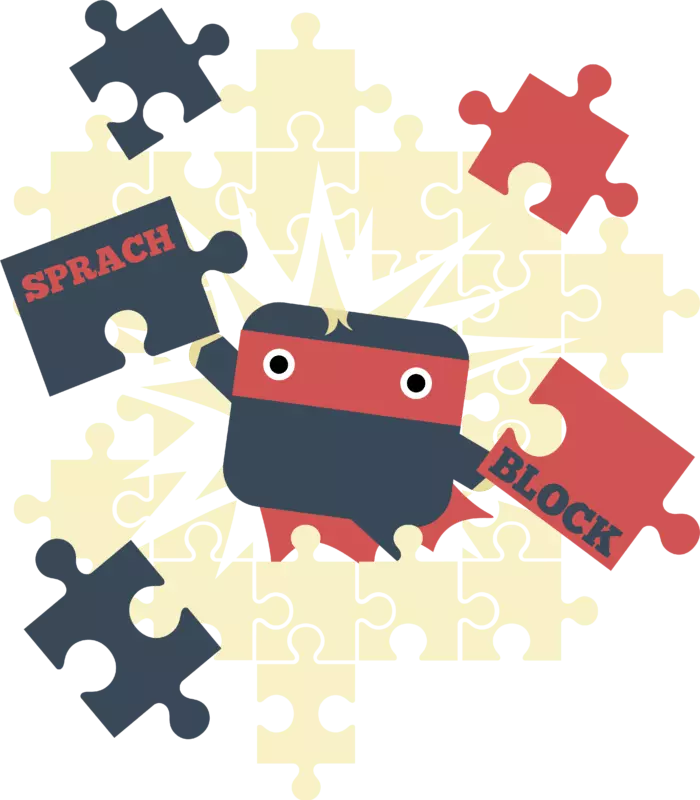Sollte ich mein Kind bilingual erziehen? Wie funktioniert mehrsprachige Erziehung? Und welche Vorteile bietet die bilinguale Erziehung für Kinder?
In diesem Artikel beantworten wir diese und weitere Fragen zur bilingualen/mehrsprachigen Erziehung. Dafür haben wir mit Sprachexperten (Prof. Jürgen Meisel), Polyglotten (Tetsi Yung und Félix Wang) und Eltern mehrsprachiger Kinder (Richard Simcott) Interviews geführt. Auch haben wir Meinungen von Leuten einbezogen, die selbst mehrsprachig aufgewachsen sind. Die Highlights der Interviews sowie wertvolle Tipps für Eltern haben wir für Dich zusammengefasst.
Die 6 wichtigsten Tipps in Kürze
- Zweite Sprache durch stetigen Kontakt normalisieren
Normalisiere die Zweitsprache, indem Du sie in verschiedenen Kontexten verwendest, besonders außerhalb des Hauses.- Kind hervorheben, wenn es die zweite Sprache spricht
Motiviere das Kind, indem Du seine Sprachkenntnisse lobst und ihm die Gelegenheit gibst, sein Wissen zu zeigen.- Mach es im Interesse des Kindes, in der Fremdsprache zu sprechen
Überzeuge das Kind vom Nutzen der Fremdsprache, zum Beispiel durch konkrete Vorteile in bestimmten Situationen.- Sprachen in Raum und Zeit klar voneinander trennen
Schaffe klare Trennungen zwischen den Sprachen, sei es durch verschiedene Orte oder bestimmte Aktivitäten.- Wenn möglich: An einen Ort ziehen, an welchem viele Sprachen gesprochen werden
Wenn die Umgebung viele Sprachen bietet, erleichtert dies die mehrsprachige Erziehung.- Bonus-Tipp: Das Kind über die Sprachen aufklären
Erkläre dem Kind frühzeitig, warum es mehrere Sprachen lernt, und lasse ihm die Freiheit, seine Sprachen selbst zu wählen.
Bilinguale Erziehung Übersicht
1. Welche Vorteile bietet die bilinguale bzw. mehrsprachige Erziehung für Kinder?
Die bilinguale/mehrsprachige Erziehung bietet eine Vielzahl an Vorteilen, vor allem, wenn man sie früh zu lernen beginnt.
- Mehrsprachigkeit ermöglicht Kindern einen vielseitigen Austausch
Je mehr Sprachen man spricht, desto mehr Menschen erreicht man. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn mit einer neuen Sprache auch das Verständnis für die Kultur der Sprache erworben wird.
- Mehrsprachigkeit ist ein riesiger Vorteil im professionellen Leben
Man kann potentiell in verschiedenen Ländern und verschiedenen Feldern arbeiten. Die Kenntnisse mehrsprachiger Leute werden in vielen Branchen benötigt: z.B. in der Politik, im Sozial- und Bildungswesen oder im Rechtswesen.
- Je mehr Sprachen man lernt, desto einfacher wird das Sprachenlernen
Polyglotte, die z.B. mehrere romanische Sprachen sprechen, können dies bestätigen. Wer bereits Deutsch spricht, lernt Spanisch leichter. Mit Spanisch ist Französisch leichter und Italienisch sogar noch leichter. Man lernt also nicht nur die Sprache, sondern auch das Sprachenlernen.
Übrigens: Ein Polyglott ist jemand, der 3 oder mehr Sprachen fließend sprechen kann.
2. Zweisprachige Erziehung – Was sagen Experten?
Richard Simcott

Richard Simcott erzieht seine Tochter 5-sprachig. Er selbst kommt aus England, wohnt in Mazedonien und hat bereits über 50 Sprachen gelernt. Dutzende davon spricht er fließend, unter anderem deutsch.
Richard ist eine weltweite Autorität zum Thema Sprachen lernen. Er wurde vom deutschen Goethe Institut als „Ambassador for Languages“ ausgezeichnet und ist aktiv an der Organisation der Polyglot Conference beteiligt.
In unserem Interview offenbart er, wie er seine Tochter 5-sprachig erzieht und teilt wertvolle Tipps, mit denen Du es auch schaffen kannst.
- Zweite Sprache durch stetigen Kontakt normalisieren.
Ein Kind will eine Fremdsprache nur dann sprechen, wenn es den Grund dafür sieht. Wenn jedoch die Zweitsprache nur zuhause gesprochen wird, erkennt das Kind den Nutzen und damit den Vorteil nicht.
Wenn Richard also mit seiner Tochter bei einer deutschsprachigen Familie zu Besuch ist, wechselt er mit ihr auf deutsch und für sie wird es zur Normalität.
- Kind hervorheben, wenn es die zweite Sprache spricht.
Gib dem Kind eine Chance, sein Wissen zur Schau zu stellen. Oft motiviert es Kinder, wenn sie schlauer als andere (besonders schlauer als die eigenen Eltern) sein und dies zeigen können.
Wenn Richard mal ein Wort auf Deutsch nicht kennt, fragt er seine Tochter und sie antwortet ihm immer mit Stolz.
- Mach es im Interesse des Kindes, in der Fremdsprache zu sprechen.
Ein Kind muss den Vorteil darin sehen, die Fremdsprache zu sprechen. Dass es in Zukunft besser zurechtkommt, ist aber kein besonders wirksames Argument, weil die Zukunft von Kindern nur sehr kurzfristig gesehen wird (Was ist nächste Woche?).
Als Beispiel nennt Richard eine Situation, in der er seiner Tochter eine Überraschung angeboten hat. Diese konnte sie jedoch nur in Anspruch nehmen, weil sie ein Gespräch auf Deutsch geführt hat.
- Sprachen in Raum und Zeit klar voneinander trennen.
Damit ein Kind die Sprachen nicht vermischt und durcheinander kommt, ist es wichtig, dass diese immer eine klare Trennung voneinander haben.
z.B. wird zu Hause nur eine Sprache gesprochen und außerhalb eine andere. Oder bestimmte routinierte Aktivitäten sind immer nur in einer Sprache, wie der Spaziergang in der Stadt. So weiß das Kind immer automatisch, zu welchem Zeitpunkt welche Sprache gesprochen wird.
- Wenn möglich: An einen Ort ziehen, an welchem viele Sprachen gesprochen werden.
Einer der Gründe, warum Richard mit seiner Familie nach Mazedonien gezogen ist, war, dass eine mehrsprachige Erziehung in England schwer war, weil dort eben alle Englisch sprechen.
In Mazedonien ist es ganz normal, viele verschiedene Sprachen zu sprechen, und so war es auch einfacher für seine Tochter, sich darauf einzulassen.
Wenn es also möglich ist, in ein anderes Land oder zumindest eine mehrsprachige Stadt (wie z.B. Berlin) zu ziehen, wird es einfacher, das Kind mehrsprachig aufwachsen zu lassen.
- Das Kind über die Sprachen aufklären.
Richard hat seine Tochter, als sie noch 3 Jahre alt war, darüber aufgeklärt, warum sie viele verschiedene Sprachen spricht und dass es natürlich ihr überlassen ist. Wenn Kinder komplett aufgeklärt sind, ist es einfacher für sie, sich auf eine andere Sprache einzulassen.
- Das Kind für seine Sprachkenntnisse loben
Richards Tochter freut sich, wenn sie von anderen für ihre Kenntnisse von Sprachen gelobt wird. Das funktioniert besonders im mehrsprachigen Mazedonien sehr gut. Also sollte das Kind, wenn möglich, von den Eltern, aber auch von anderen viel Lob über die Sprachkenntnisse erhalten.
- Das Kind mit der Fremdsprache unabhängig und selbstständig sein lassen.
Kinder wollen möglichst autonom sein. Wenn sie die Möglichkeit haben, dies in einer Fremdsprache zu tun, sind sie umso motivierter, diese anzuwenden.
Richard lässt seine Tochter Bestellungen im Ausland durchführen. So kann sie einerseits selbstständig sein und andererseits die Sprache anwenden. So sieht sie noch mehr den Sinn darin, mehrsprachig zu sein.
Siehe Dir hier das vollständige Interview mit Richard Simcott an:
Tetsu Yung
Tetsu ist 5-sprachig in Taiwan aufgewachsen. Gebürtig stammt er aus Hong Kong, sein Vater aus Taiwan und seine Mutter aus Japan. Mit seiner Mutter spricht er Japanisch und mit seinem Vater Mandarin. Mit 6 ging er auf eine amerikanische Schule und wanderte später nach Kanada aus, wo er Französisch lernte.
Tetsu hat das Buch „Pampers to Polyglot“ geschrieben, in dem es um mehrsprachige Erziehung geht.
Ebenfalls ist er der Organisator des Treffens Langfest, wo sich Sprachbegeisterte und Polyglotte in Montreal zu einem Austausch und für Vorträge treffen.
Im Interview teilt er seine Sichtweise auf bilinguale/mehrsprachige Erziehung.
- Tetsu ist im Endeffekt sehr froh, mit so vielen Sprachen aufgewachsen zu sein.
Da er heutzutage die vielen Vorteile einer mehrsprachigen Erziehung kennt, will er dies auch seinen Kindern weitergeben.
- Muttersprachen so früh wie möglich mit dem Kind sprechen.
Am besten sogar, während es noch im Bauch ist, damit es sich früh an die Sprachen gewöhnt.
- Eine Sprache pro Person.
Eine Person sollte nur eine Sprache mit dem Kind sprechen. Jedes Elternteil könnte eine Sprache sprechen, aber auch Kindermädchen, Großeltern und andere können ihre eigenen Sprachen mitbringen und mit den Kindern sprechen. So ist es auch der Fall bei Tetsus Kindern.
- Man muss nicht jeden Tag jahrelang eine Sprache sprechen, um sie auf Muttersprachenniveau zu beherrschen.
Forschung hat gezeigt, dass 20% des Kontaktes eines einsprachigen Kindes völlig ausreicht. Nach dieser Theorie ist es also möglich, bis zu 5 Sprachen auf muttersprachlichem Niveau zu beherrschen, wenn das Kind mit allen jeweils 20% Kontakt hat.
- Kinder niemals zwingen, eine bestimmte Sprache zu sprechen.
Lieber sollte man sie motivieren, indem man ihnen Vorteile durch das Sprechen bietet. Also wenn sie etwas von den Eltern wollen, dann bekommen sie das nur, wenn sie in der richtigen Sprache fragen.
Siehe Dir hier das vollständige Interview mit Tetsu Yung an:
3. Mehrsprachige Erziehung
Prof. Jürgen Meisel
Prof. Jürgen Meisel ist Professor für romanische Philologie der Uni Hamburg im Ruhestand und an der Universität Calgary in Kanada als adjunct Professor. Zurzeit arbeitet er an einem Ratgeber für Eltern zum Thema multilingualer Spracherwerb.
Aus seiner Sicht hat der Mensch eine angeborene Sprachfähigkeit und somit auch die natürliche Möglichkeit, mehrere Sprachen zu erlernen. Zwei Faktoren sind hierbei entscheidend:
- Das Alter des Kindes ist entscheidend für sein sprachliches Potential.
- 90% des Spracherwerbs eines Kindes erfolgt zwischen dem 1. und 4. Lebensjahr.
- Während Kinder neue Sprachen generell besser aufnehmen können als Erwachsene, zeichnen sich dennoch bereits zwischen dem 4. und 7. Lebensjahr negative Unterschiede in der Aufnahmefähigkeit ab. Diese werden durch neuronale Veränderungen in diesem Stadium verursacht, die Wahrscheinlichkeit einer optimalen Bildung von Syntax (Satzbau) und Phonologie (Aussprache / Akzent) nimmt ab. Darum sollte die Aufnahme bereits von Geburt an optimal unterstützt werden.
- Zwischen dem 7. und 11. Lebensjahr wird das Gelernte schlussendlich gefestigt; diese Konsolidierungsphase ist sehr wichtig für die zukünftige Fähigkeit, die Sprache einzusetzen.
- Das Level an sprachlichem Input ist bedeutend.
- Es ist wichtig für das Kind, den Sprachen ausreichend ausgesetzt zu sein. Kinder können durch normale Interaktion gewinnbringend lernen, es sind nicht zwingend eigene Erziehungsmaßnahmen nötig.
- Durchaus wichtig ist aber die konsequente Fortführung der Sprachbildung. Eine vielfältige Auseinandersetzung mit beiden Sprachen – die sich nicht nur auf bestimmte Themen beschränkt – ist essentiell, um nicht in einer Sprache zwar flüssig, aber auf einem niedrigen Level zu sprechen.
- Es ist also nicht nur wichtig, bilingual, sondern vor allem bikulturell gebildet zu werden, damit das Kind beide Kulturen auch versteht.
- Prof. Meisels Empfehlung an Eltern
- Zuallererst sollte viel mit dem Kind gesprochen werden. Der Spracherwerb erfolgt nur durch Sprache, die direkt an das Kind gerichtet ist. Passive Aufnahme wie Fernsehen oder das Überhören von Gesprächen ist nicht ausreichend; es muss sich um Interaktionen handeln.
- Wenn durchgehend viel geredet wird, dann ist auch bei Verwendung von zwei oder mehr Sprachen der nötige Input gedeckt.
- Außerdem sollte die Sprachbildung kontinuierlich gestärkt werden. Ein zwischenzeitlicher Abbruch einer Sprache ist unbedingt zu vermeiden.
Siehe Dir hier das vollständige Interview mit Prof. Jürgen Meisel an:
Félix Wang
Félix ist ein bekannter Internet-Polyglott und macht schon seit Jahren Videos zum Thema Sprachen lernen auf YouTube, wo er Tipps zum Sprachen lernen gibt und verschiedene Sprachen spricht.
Felix beherrscht über 10 Sprachen. Er ist mehrsprachig aufgewachsen mit Französisch und dem Chinesisch-Dialekt Teochew, was auch das Hauptthema unseres Interviews war.
Seine Erfahrung mit Mehrsprachigkeit teilt er uns wie folgt mit.
- Einerseits wuchs er in einer ziemlich internationalen Stadt (Brüssel) auf, andererseits war er auf einer flämischen Schule im französischsprachigen Brüssel. Er hat aber nie zu Hause gegen die Sprache seiner Eltern rebelliert.
- Den Chinesisch-Dialekt Teochew spricht er auf einem niedrigeren Level als Flämisch und Französisch, obwohl er diese Sprache zu Hause gesprochen hat.
- Sein Interesse für Fremdsprachen begann erst im späteren jugendlichen Alter, als er mit Spanischsprachigen in Kontakt kam. Ab diesem Moment wollte er Spanisch lernen, um sich mit ihnen unterhalten zu können. Da er bereits Französisch sprechen konnte, war Spanisch kein Problem für ihn.
- Er glaubt nicht, dass ihm die dreisprachige Erziehung beim Erlernen von anderen Sprachen geholfen hat. Aber es hat ihm geholfen, ähnliche Sprachen zu lernen. z.B. war es kein Problem für ihn, Mandarin zu lernen oder eben Spanisch, weil er ähnliche Sprachen bereits beherrschte.
Siehe Dir hier das vollständige Interview mit Felix Wang an: